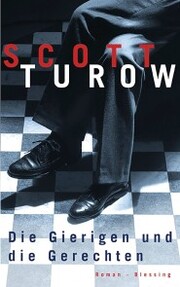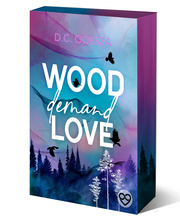Der Befehl (kartoniertes Buch)
Der Befehl
Ordinary Heroes
Roman
Erschienen am
03.09.2007
Auch verfügbar als:
Bibliographische Informationen
ISBN/EAN: 9783453432543
Sprache: Deutsch
Seiten: 544 S.
Fomat (h/b/t): 3.6 x 18.8 x 11.8 cm
Bindung: kartoniertes Buch
Autorenportrait
Scott Turow, Jahrgang 1949, ist Schriftsteller und Anwalt. Er schrieb bereits zahlreiche in über 25 Sprachen übersetzte Romane, darunter sein Debüt Aus Mangel an Beweisen (1987) - verfilmt mit Harrison Ford auch ein enormer Kinoerfolg - und dessen lang erwartete Fortsetzung Der letzte Beweis (Blessing 2010), alle im fiktiven, dem Großraum Chicago nachempfundenen Kindle County angesiedelt. Er verfasste zudem zwei Sachbücher - One L, über seine Erfahrungen als Jurastudent, und Ultimate Punishment, eine Betrachtung der Todesstrafe. Turow, seit 1986 Partner einer in Chicago ansässigen Anwaltskanzlei, befasst sich mit Wirtschaftsstrafsachen und widmet zugleich einen Großteil seiner Zeit pro-bono-Mandaten. Er saß in zahlreichen Gremien - darunter die 2000 von Gouverneur George Ryan berufene Illinois Commission on Capital Punishment, die Reformen für die Todesstrafe in Illinois anregte -, und hatte den ersten Vorsitz der 2004 gegründeten Executive Ethics Commission, die Vorgaben für Angestellte der Exekutive des Staates Illinois erstellte. Darüber hinaus war er Vorsitzender der Authors Guild. Turow lebt in der Nähe von Chicago.
Leseprobe
1 Stewart: Alle Eltern haben Geheimnisse Alle Eltern haben Geheimnisse vor ihren Kindern. Mein Vater hatte anscheinend noch mehr als üblich. Der erste Verdacht kam mir, als Dad 2003 mit achtundachtzig Jahren starb, nachdem er in ein wahres Bermudadreieck von Krankheiten geraten war - schwaches Herz, Lungenkrebs und ein Emphysem -, alles mehr oder weniger auf sechzig Jahre Zigarettenkonsum zurückzuführen. Meine Mutter legte die ihr typische Entschlossenheit an den Tag und weigerte sich, die Einzelheiten der Beerdigung meiner Schwester und mir zu überlassen. Sie wollte unbedingt mit zu dem Bestattungsinstitut kommen. Der Sarg, den sie aussuchte, war derart groß, dass er schon fast nach einer Kühlerfigur verlangte, und sie grübelte über jedes Wort der empfohlenen Todesanzeige nach, die der Bestatter uns vorlas. 'War David vielleicht Kriegsveteran?', fragte er. Der Bestatter war der adretteste Mensch, den ich je gesehen hatte, mit polierten Fingernägeln, in Form gezupften Augenbrauen und einem so glatten Gesicht, dass ich eine Elektrolysebehandlung vermutete. 'Zweiter Weltkrieg', blaffte meine Schwester Sarah, die selbst mit zweiundfünfzig Jahren noch immer den Ehrgeiz hatte, mir mit ihren Antworten zuvorzukommen. Der Bestatter zeigte uns das schwarze Emblem mit dem flatternden Sternenbanner, das in der Zeitung neben dem Namen meines Vaters stehen würde, doch meine Mutter schüttelte bereits vehement ihre schütteren grauen Locken. 'Nein', sagte sie. 'Kein Krieg. Nicht für David Dubin.' Wenn sie aufgebracht war, verließen meine Mutter schon mal die Worte. Und meine Schwester und ich fragten klugerweise nicht weiter nach, wenn sie in dieser Stimmung war. Abgesehen von den spärlichen Fakten - wie mein Vater, ein amerikanischer Offizier, und meine Mutter, Häftling in einem deutschen Konzentrationslager, sich praktisch auf den ersten Blick ineinander verliebt hatten -, war das Thema Krieg unser ganzes Leben lang einfach zu unerfreulich gewesen, um darüber zu reden. Aber ich war immer davon ausgegangen, dass ihretwegen darüber geschwiegen wurde, nicht seinetwegen. Am letzten Tag der Trauerbesuche war meine Mutter so weit, Dads Sachen auszusortieren. Sarah sagte, sie habe nicht mehr die Zeit mitzuhelfen, und fuhr zurück zu ihrem Steuerbüro in Oakland, wobei sie sicherlich das Gefühl auskostete, im Gegensatz zu mir Arbeit zu haben. Am Montagmorgen betraute Mom mich damit, das Ankleidezimmer meines Vaters durchzusehen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, möglichst viel von seinen Sachen zu nehmen. Fast alles war katastrophal altmodisch, und nur meine Mutter konnte sich vormachen, ich hoffnungsloser Dickwanst würde irgendwann auf das Format dieser Kleidungsstücke abspecken können. Ich suchte mir ein paar Krawatten aus, um meine Mutter glücklich zu machen, und packte dann die alten Hemden und Anzüge in Kartons, als Spende für den Haven, die jüdische Hilfsorganisation, die meine Mutter fast zwanzig Jahre lang ehrenamtlich geleitet hatte. Ich war allerdings nicht auf die Gefühlsaufwallung gefasst, die mich dabei überkam. Ich kannte meinen Vater als einen distanzierten, umsichtigen Mann, in fast allen Dingen ungemein ordentlich, hochintelligent, fleißig, freundlich. Die Arbeit war ihm lieber als gesellschaftliche Ereignisse, obgleich er einen durchaus höflichen Charme besaß. Richtig erfolgreich war er jedoch in der mächtigen Bastion der Juristerei. Nirgendwo sonst fühlte er sich so wohl. Zu Hause überließ er meiner Mutter das Kommando, wobei er über fünfzig Jahre lang denselben lahmen Witz machte - als Anwalt, sagte er, hätte er nie und nimmer das Zeug dazu, einen Streit mit Mom zu gewinnen. Der Talmud sagt, dass ein Vater seinen Sohn mit der einen Hand an sich ziehen und mit der anderen wegstoßen soll. Dad versagte im Grunde bei beidem. Ich spürte zwar stets sein Interesse, das ich als Zuneigung deutete. Im Vergleich zu vielen anderen Dads war er ein Bilderbuchvater, vor allem in einer Generation, in der ein guter Vater in ers
Weitere Artikel aus der Kategorie "Belletristik/Spannung"
Neuerscheinung

Lieferbar innerhalb 24 Stunden

Derzeit nicht verfügbar

Neuerscheinung